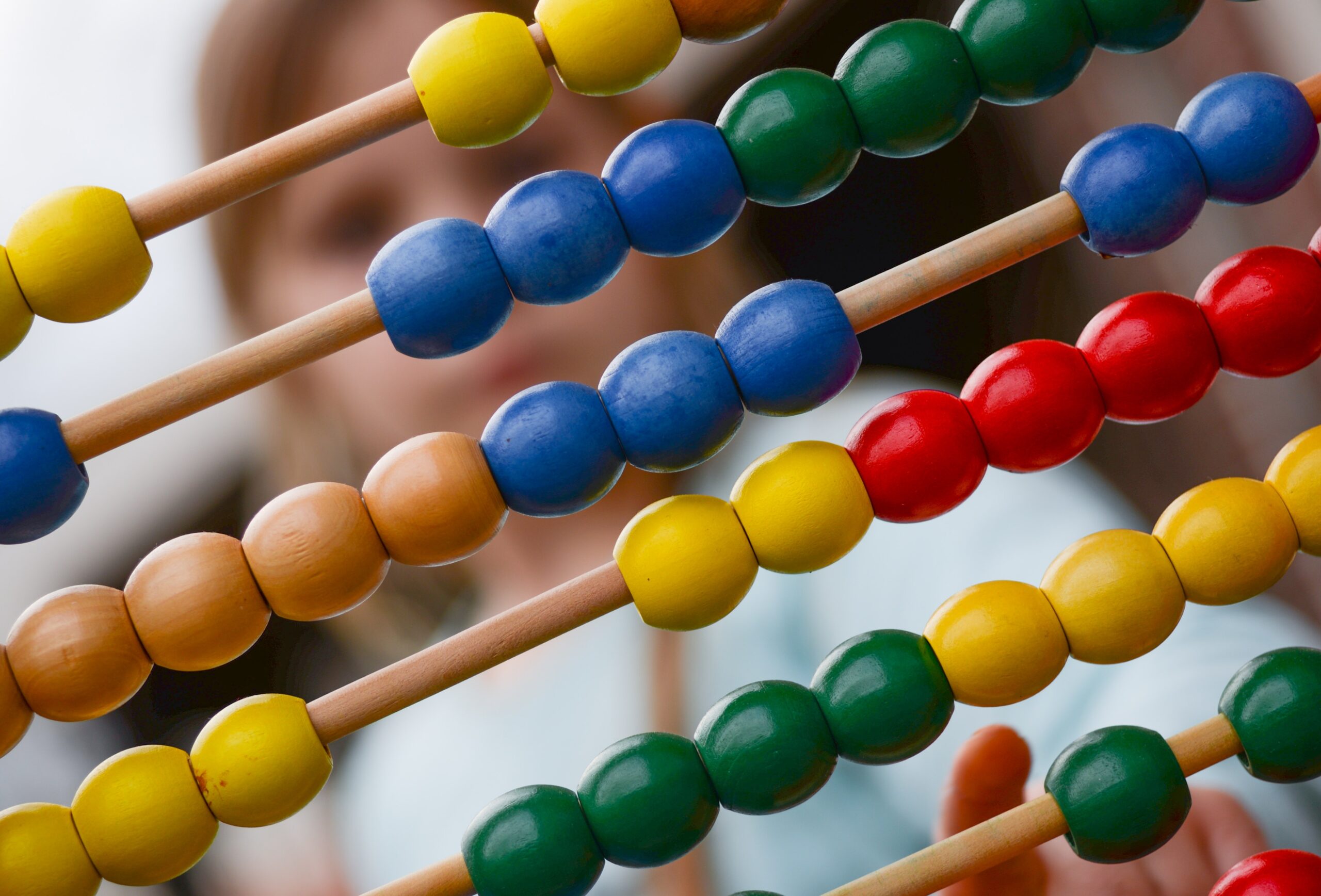
Welchen bedeutenden Entscheid für das Rätoromanische fällte das Schweizerische Stimmvolk 1938? Und weshalb ergibt seit 1996 in der Sprachpolitik 3 + ½ in den meisten Fällen 3? Eine kleine Tour d’Horizon rund um die oft vergessene und dabei schweizerischste aller Landessprachen.
Am 20. Februar 1938 fällte das Schweizer Stimmvolk einen für die rätoromanische Sprache denkwürdigen Entscheid. Es erhob das Rätoromanische mit 91,6% Ja-Stimmen zur Nationalsprache. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die hohe Zustimmung nicht nur sprachpolitische Beweggründe hatte. Im Zuge der geistigen Landesverteidigung vor dem Zweiten Weltkrieg war der Entscheid auch eine dezidierte Absage an nationalistische Tendenzen Italiens, das eine Angliederung rätoromanisch- und italienischsprachiger Gebiete der Schweiz im Sinn hatte. Bis heute geblieben ist die bedeutende Verankerung des Rätoromanischen in Artikel 4 der Bundesverfassung: Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Happy End? Fast. Wäre da nicht die Crux mit der Unterscheidung zwischen Landessprache und Amtssprache. Knapp 60 Jahre nach der Volksabstimmung von 1938 doppelte Helvetia nach: Am 10. März 1996 wurde eine Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung mit 76% Ja-Stimmen angenommen. Dieser Entscheid verleiht dem Rätoromanischen den Status einer Teilamtssprache des Bundes. Der Sprachenartikel in der Bundesverfassung hält fest, dass «im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes» ist. Die weiteren Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch.
Landessprache ohne Podestplatz
Eine integrale Bereitstellung der gesamten schriftlichen Kommunikation des Bundes auf Rätoromanisch wäre unrealistisch und zudem nicht sinnvoll. Rätoromanisch ist zwar Landessprache, jedoch nur Teilamtssprache des Bundes, sozusagen eine halbe Amtssprache. Texte von besonderer Tragweite sowie die Unterlagen für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen sollen gemäss Sprachengesetz auch in Rätoromanisch veröffentlicht werden. Und nicht zu vergessen sind die Texte «im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache». Ein Beispiel: Eine Bürgerin schreibt einen Brief auf Rätoromanisch an die Bundesverwaltung. Der Fall ist klar, die Antwort erfolgt auf Rätoromanisch. Bravo! Zweites Beispiel: Das Bundesamt für Gesundheit lanciert eine grosse schweizweite Kampagne gegen die Ausbreitung des Coronavirus, verfasst in allen … – Falsch! Es brauchte politischen Druck, um die Herausgabe von wesentlichen Informationen der Corona-Kampagne auf Rätoromanisch zu erwirken. Der Grundsatz scheint zu sein, dass alles in den drei vollwertigen Amtssprachen herausgegeben wird und erstmal explizit nicht in der Teilamtssprache. Im Grunde ist es eine arithmetische Frage. Den Rechenfehler, den der Bund bei der Interpretation der ½ Amtssprache Rätoromanisch begeht, ist, dass er den Faktor 0.5 in fast allen Fällen abrundet. In der Konsequenz ergibt dies das omnipräsente Bild der dreisprachigen Schweiz. Internetseiten, Publikationen und Beschriftungen werden in Deutsch, Französisch und Italienisch verfasst. Das Rätoromanische gerät zunehmend in Vergessenheit. Es braucht ein Umdenken. Die Landessprache auf dem undankbaren vierten Platz hätte zumindest eine lederne Medaille verdient. Wie könnte ein sinnvoller Umgang mit der ½ Amtssprache aussehen? Der Bund sowie öffentliche Dienstleister, z.B. Post und SBB, die national agieren, müssten Rätoromanisch gesamtschweizerisch konsequent bei Beschriftungen aller Art verwenden. Dies dort, wo die anderen drei Amtssprachen der Schweiz aufgeführt werden. Im rätoromanischen Sprachgebiet muss die Sprache prioritär für Informationen an die Bevölkerung eingesetzt werden.
Bedroht trotz guter Rechtsstellung
Laut einem im Jahr 2019 erschienenen Evaluationsbericht im Auftrag des Bundes besteht für das Rätoromanische bereits mittelfristig die Gefahr einer existenziellen Bedrohung. Der Bericht empfiehlt u.a. eine vermehrte Förderung des Rätoromanischen ausserhalb des traditionellen Verbreitungsgebiets der Sprache, insbesondere die Bereitstellung von Bildungsangeboten auch ausserhalb des Kantons Graubünden. Im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-24 wendet der Bund insgesamt rund 21 Mio. für das Rätoromanische auf. Erstmals entrichtet der Bund in dieser Periode Beiträge in der Höhe von 1,2 Mio. für Fördermassnahmen ausserhalb des angestammten Sprachgebiets. Ein Vorhaben verdeutlicht sinnbildlich die grossen Anstrengungen, das Rätoromanische auch an die nächste Generation weiterzugeben. Mit einem neuen online zugänglichen Bildungsangebot, genannt «Rumantsch a distanza» (Rätoromanisch im Fernunterricht), sollen Jugendliche auch ausserhalb des rätoromanischen Sprachgebiets ab dem Schuljahr 2023/24 die Sprache erlernen können. Aber wird die Förderung fruchten, wenn das Rätoromanische nirgends auf der Sprachlandkarte der Schweizer Bevölkerung erscheint? Präsenz im Alltag ist der Schlüssel: Der Bund sowie öffentliche Dienstleister auf nationaler Ebene sind gefordert und aufgefordert, nachzuziehen. Und dann ist auch klar, was die sprachpolitisch-arithmetische Gleichung 3 + ½ in der viersprachigen Schweiz ergibt. Auf jeden Fall mehr als 3.
Rumantsch – fünf Idiome, eine Sprache
Das Rätoromanische gliedert sich in fünf verschriftlichte Idiome (Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter und Vallader) und verfügt über eine Standardschriftsprache, das Rumantsch Grischun. Rund 60’000 Personen in der Schweiz sprechen die Sprache. Ein Drittel der Romanischsprachigen lebt ausserhalb des Kantons Graubünden. In Gemeinden im rätoromanischen Sprachgebiet ist Rätoromanisch Amts- und Schulsprache. Im Kanton Graubünden sind Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch die drei gleichwertigen Landes- und Amtssprachen.
von Andreas Gabriel, Stellvertretender Generalsekretär der Lia Rumantscha
Die Lia Rumantscha ist die Dachorganisation der rätoromanischen Sprachförderung. Im Auftrag des Bundes und des Kantons Graubünden vertritt sie die Interessen des Rätoromanischen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Die GMS befürwortet muslimische Grabfelder in Weinfelden
In Weinfelden wird derzeit heftig über die Schaffung muslimischer Grabfelder diskutiert. Erst vom Weinfelder Stadtparlament bewilligt, wurde gegen den Entscheid das Referendum ergriffen. Während sich ein SVP-Nationalrat eines diskursiven Manövers bedient, bleibt die GMS klar in ihrer Haltung und Aussage. Die GMS fordert einen Diskurs um das «Wie» und nicht das «Ob». Diskriminierende Äusserungen dürfen auch in diesem Zusammenhang nicht toleriert und politische Kampagnen nicht auf dem Rücken der Minderheiten ausgetragen werden.
Lesen Sie in unserer Medienmitteilung sieben aussagekräftige Argumente für muslimische Grabfelder und schauen Sie sich unseren Beitrag vom 31. Januar 2025 auf Tele Top an.